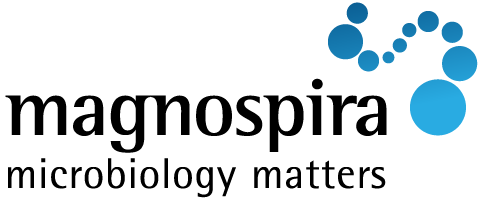Tsunami im Darm
Im Jahr unterziehen sich in Deutschland ca. 1,5–2 Mio. Menschen einer Darmspiegelung (Koloskopie). Dabei untersucht der Arzt mit einem Endoskop den Darm auf Veränderungen. Voraussetzung hierfür ist eine gründliche Darmreinigung. Wie beeinflusst jedoch diese drastische Spülung das Mikrobiom, welche Risiken bestehen und was kann getan werden, damit das komplexe Zusammenspiel der Mikroorganismen nicht nachhaltig gestört wird?
60.000 Erkrankungen an Darmkrebs pro Jahr
Jedes Jahr erkranken in Deutschland etwa 60.000 und in den USA rund 150.000 Menschen an Darmkrebs. Je später entartete Zellen im Darm erkannt werden, desto geringer sind die Heilungs- und Überlebensraten. Während bei einer Diagnose im frühen Stadium fünf Jahre danach noch über 80–90 % der Erkrankten leben, sinkt die 5‑Jahres‑Überlebensrate bei fortgeschrittener Erkrankung auf etwa 10–15 %. Daher wird eine Darmspiegelung i.d.R. spätestens ab dem 50. Lebensjahr empfohlen und alle 5–10 Jahre wiederholt. Bei der Vorbereitung auf eine solche Untersuchung spielt die Darmflora und Darmreinigung eine entscheidende Rolle. Obwohl alternative Untersuchungsmethoden (wie immunologische Stuhltests oder virtuelle Koloskopien) existieren und geringfügige Risiken (wie Darmperforation oder Blutungen) bestehen, gilt die Koloskopie weltweit als Goldstandard.
Wie funktioniert eine Darmreinigung?

Vor einer Koloskopie muss der Darm vollständig entleert werden, um dem Gastroenterologen freie Sicht auf die Darmschleimhaut zu ermöglichen. Neben einer Ernährungsumstellung 3–5 Tage vorher, wird am Tag davor oder, bei einer Untersuchung am späten Nachmittag, noch am selben Tag, eine Darmreinigung mittels spezieller Abführmittel eingesetzt. Am häufigsten verbreitet sind dabei PEG (Polyethylenglykol)-basierte Lösungen, die einen osmotischen Effekt im Darm erzeugen. PEG ist ein langkettiges Polymer, das vom Darm nicht aufgenommen wird und somit Wasser bindet. Dies führt zu einer starken Verdünnung und Verflüssigung des Darminhalts. Durch die in den PEG-Lösungen enthaltenen Elektrolyte wird ein starker Verlust von Mineralstoffen vermieden. Das hohe Flüssigkeitsvolumen löst einen starken Durchspüleffekt aus und durch die Darmbewegung (Peristaltik) wird mit mehreren wässrigen Stuhlgängen der Darm gründlich gereinigt.
Wird die Darmflora bei der Darmreinigung geschädigt?
Auch wenn nur selten Nebenwirkungen auftreten, und da vor allem bei Personen mit Herz- oder Nierenerkrankungen, stellt sich die Frage, welche Auswirkungen diese radikale Darmsäuberung auf das Mikrobiom hat. Denn wenn die kompletten Stuhlreste aus dem Darm geschwemmt werden, werden dann nicht auch die guten Bakterien aus dem Darm, sozusagen gewaltsam, hinausbefördert?
Die Antwort lautet eindeutig: Ja, das Mikrobiom wird empfindlich beeinflusst. Anzumerken gilt jedoch, dass nur das Darmmikrobiom in Mitleidenschaft gezogen wird. Alle anderen Mikrobiome des Menschen, auf der Haut, im Magen, im Mund und eigentlich überall auf und im Körper werden dadurch nicht beeinträchtigt, sondern die Wirkung der Darmreinigung bleibt alleinig auf den Darm beschränkt.
Wie verändert sich die Darmflora während der Darmreinigung?
Die Einnahme der Abführlösung führt zu einer massiven Reduktion der Bakterienmenge im Darm. Studien zeigen, dass unmittelbar nach der Darmreinigung die Gesamtzahl der Darmflora um Größenordnungen abnimmt – in einer Untersuchung um etwa das 31-Fache. Dadurch geht ein Teil der individuellen Zusammensetzung (die „fingerabdruckartige“ Spezifität) des Mikrobioms vorübergehend verloren . Nützliche Bakterien werden stark reduziert, gleichzeitig können verhältnismäßig resistente oder schleimhautnahe Keime überproportional zurückbleiben oder sich vorübergehend vermehren.
Rückgang der Diversität nach der Darmreinigung
Die Auswirkungen sind vergleichbar mit starken Durchfallerkrankungen. Die generelle Diversität der Darmflora nimmt ab, während einige Bakterien kurzfristig zunehmen können. Dies ist auch z.B. bei einer Choleraerkrankung der Fall. Hier kann der Verursacher der Choleraerkrankung, Vibrio cholerae, durch seine starke Beweglichkeit, den von seinen eigenen Giften verursachten starken Darmbewegungen, Gegenwehr bieten. Während also andere Keime ausgewaschen werden, bleibt er im Darm erhalten und kann sich dadurch einen Wachstumsvorteil sichern.
Bei den Auswirkungen der Darmreinigung spielt es ebenfalls eine Rolle, welchen Ausgangszustand das Mikrobiom hat. So sind manche Mikrobiome anfälliger für den Verlust der Diversität bei einer Darmreinigung als andere. Das bedeutet, dass die Zusammensetzung des Mikrobioms nach der Darmreinigung je nach Ausgangslage variiert. Ein gesundes Mikrobiom bietet also auch hier erhebliche Vorteile.
Auch Sauerstoff schädigt Darmbakterien
Ein weiterer Faktor ist Sauerstoff, der während der Koloskopie in den Darm eingebracht werden kann: Darmkeime vertragen in der Regel keinen Sauerstoff. Bei Verwendung von Raumluft können sie zusätzlich geschädigt werden. Deshalb nutzt man heutzutage Kohlendioxid (CO₂), das besser verträglich ist, schneller entweicht und Blähungen reduziert.
Schnelle Regeneration der Darmflora nach Darmreinigung
Trotz dieser drastischen Methode hat das Darmmikrobiom eine bemerkenswerte Regenerationsfähigkeit. Der ursprüngliche Zustand stellt sich meist innerhalb von 2–4 Wochen wieder ein, nach 6 Wochen ist die Darmflora fast vollständig regeneriert. Dennoch können in seltenen Fällen einzelne Populationen dauerhaft geschädigt bleiben, besonders wenn schon vorher ein Ungleichgewicht vorlag.
Warum erholt sich die Darmflora so schnell?

Doch warum ist das Darmmikrobiom so resilient? Im Gegensatz zu Antibiotika tötet die Darmreinigung die Bakterien nicht, sondern spült sie lediglich aus. Einzelne Vertreter können sich aber in Darmausstülpungen oder anderen Nischen den Turbulenzen entziehen. Sobald die Darmreinigung vorbei ist, können sie sich anschließend wieder vermehren, solange keine krankmachenden Keime dominieren. So kann das ursprüngliche Darmmikrobiom in relativ kurzer Zeit wiederhergestellt werden.
Praktische Tipps zur Unterstützung der Darmflora nach einer Darmreinigung
Wie kann das Darmmikrobiom nach einer Darmreinigung unterstützt werden?
1. Split-Dosis-Schema
Dabei wird die Abführlösung auf zwei getrennte Zeitpunkte verlagert. Das Mikrobiom wird auf diese Weise weniger gestört, als wenn die gesamte Dosis auf einmal genommen wird. Daher wird heutzutage das Split-Dosis-Schema bevorzugt.
2. Gezielter Einsatz von Probiotika

Der Einsatz von Probiotika nach der Darmreinigung mit anschließender Koloskopie hilft, die Mikrobiomveränderungen abzumildern, indem bestimmte Bakteriengattungen schneller wiederhergestellt werden. Dabei ist jedoch der Einnahmezeitpunkt entscheidend: Die Probiotika sollten unmittelbar nach der Darmspiegelung genommen werden – je eher, desto besser. Entscheidend ist auch die Zusammensetzung der einzelnen Probiotikapräparate, denn sie dienen ja als “Anschub” für die Wiederherstellung der Darmflora. Enthalten die Probiotika nicht einige der Bakterien, die ursprünglich in der Darmflora vorhanden waren, so kann auch keine beschleunigte Regeneration eintreten. Da jedes Darmmikrobiom individuell ist, müsste idealerweise eine Analyse der Zusammensetzung auf die wichtigsten Bakteriengruppen vor der Darmreinigung stattfinden, und diese dann anschließend gezielt durch ein Probiotikum wieder zugesetzt werden. Diese Personalisierung ist zwar der beste Weg, wird aber kaum praktiziert.
3. Ernährung
Wie oben beschrieben, werden die Bakterien nicht wie bei einer Antibiotika-Atombombe ausgelöscht, sondern existieren noch im Darm, wenngleich auch in geringen Mengen. Daher ist es wichtig, sie sofort nach der Darmspiegelung wieder zu unterstützen, am besten mit Ballaststoffen, die nur diese Mikroorganismen verarbeiten können. Dies geschieht am besten mit einer pflanzenreichen und faserhaltigen Ernährung oder durch die Gabe von speziellen Präbiotika wie Inulin. Fermentierte Lebensmittel wie Joghurts, Kefir, Sauerkraut oder Kimchi liefern ebenfalls nützliche Mikroorganismen und können die Neubesiedlung unterstützen. Wichtig ist, dem Darm Zeit zur Erholung zu geben: Direkt nach der Spiegelung sollte man mit leichter Kost beginnen und dann auf vollwertige, probiotika- und präbiotikareiche Nahrung umstellen, um das Wachstum einer gesunden Darmflora zu fördern.
Kein dauerhafter Schaden durch Darmreinigung
Die Darmreinigung vor einer Koloskopie verursacht in der Regel keinen bleibenden Schaden. Zwar wird das Mikrobiom kurzfristig empfindlich gestört, regeneriert sich jedoch rasch. Problematisch wäre es hingegen, wenn unmittelbar nach einer Darmreinigung ein Antibiotikum verabreicht würde, da sich diese beiden Effekte negativ verstärken können.
Im Normalfall aber kann sich mit der richtigen Unterstützung das Darmmikrobiom schnell und zuverlässig regenerieren. (JS)
Weiterführende Literatur
Jalanka J. et al. (2015): Effects of bowel cleansing on the intestinal microbiota. Gut 64(10):1562-1568. DOI: 10.1136/gutjnl-2014-307240
Drago L. et al. (2016): Persisting changes of intestinal microbiota after bowel lavage and colonoscopy. Eur J Gastroenterol Hepatol 28(5):532-537. DOI: 10.1097/MEG.0000000000000581
Jo H.H. et al. (2023): Alteration in gut microbiota after colonoscopy: proposed mechanisms and the role of probiotic interventions. Clinical Endoscopy 56(3):239-249. DOI: 10.5946/ce.2022.158
Labenz J. et al. (2023): Application of a multispecies probiotic reduces gastrointestinal discomfort and induces microbial changes after colonoscopy. Front Oncol 12:1078315. DOI: 10.3389/fonc.2022.1078315
Son D. et al. (2023): Benefits of Probiotic Pretreatment on the Gut Microbiota and Minor Complications after Bowel Preparation for Colonoscopy. Nutrients 15(5):1141. DOI: 10.3390/nu15051141
Tseng C.H. et al. (2019): Gut microbiome changes in overweight male adults following bowel preparation. BMC Genomics 19(Suppl 10):904. DOI: 10.1186/s12864-018-5285-6