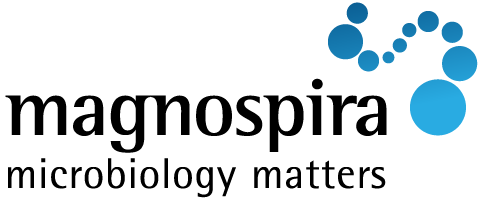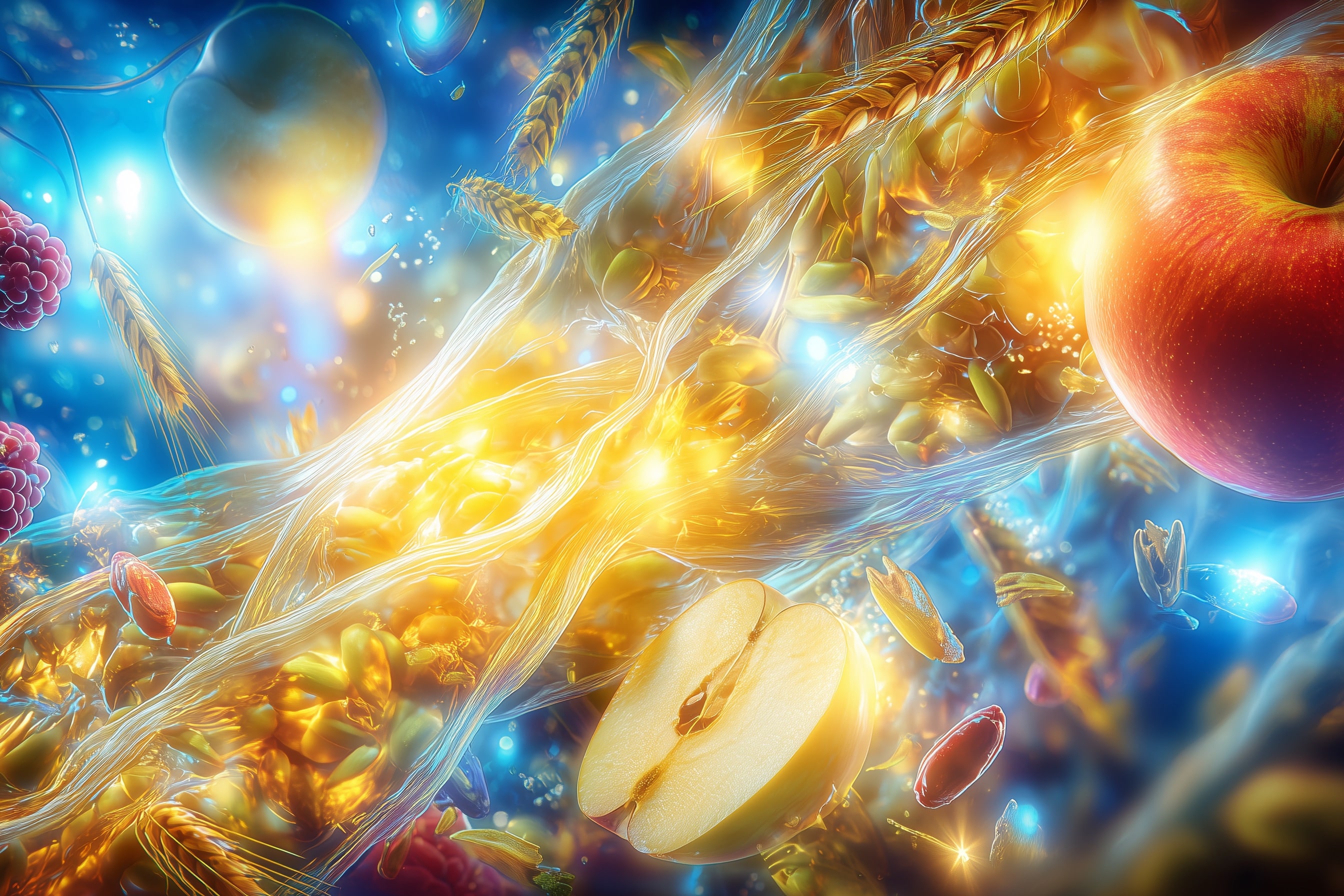Verlorenes Gleichgewicht
Eine vaginale Dysbiose ist für viele Frauen eine enorme physische und psychische Belastung. Dabei gerät die Vaginalflora aus dem Gleichgewicht und ungünstige mikrobielle Populationen gewinnen die Oberhand. Wenn die Störung fortschreitet, kann sie die Lebensqualität massiv beeinträchtigen. Doch wie genau entsteht eine bakterielle Vaginose, und wie lässt sie sich wirksam behandeln?
Laut wissenschaftlichen Studien leiden 5–10 % aller Frauen im gebärfähigen Alter in Deutschland an bakterieller Vaginose. Weltweit wird der Anteil sogar auf etwa 25 % geschätzt. Besonders Schwangere in Deutschland sind mit rund 20 % häufig betroffen. Der Leidensdruck ist hoch – nicht nur wegen körperlicher Beschwerden, sondern auch, weil viele Frauen sich durch die Symptome aus dem sozialen Leben zurückziehen.
Was ist eine bakterielle Vaginose?
Die bakterielle Vaginose ist eine spezielle Form der fortgeschrittenen vaginalen Dysbiose. Dabei gerät das Gleichgewicht des vaginalen Mikrobioms aus der Balance und für den Körper ungünstige mikrobielle Populationen können die Oberhand gewinnen.
Die Vaginalflora ist ein fein abgestimmtes Zusammenspiel verschiedener Mikroorganismen, allen voran Laktobazillen, die durch die Senkung des pH-Wertes für eine stabile, schützende Umgebung sorgen. Bei einer bakteriellen Vaginose hingegen dominieren anaerobe Bakterien wie Gardnerella, Prevotella und Atopobium. Auch Hefepilze können sich übermäßig vermehren. Dieses Krankheitsbild bezeichnet man als vulvovaginale Candidose, die durch eine starke Besiedlung mit Candida gekennzeichnet ist. Bakterielle Vaginose und Pilzinfektionen sind unterschiedliche Seiten derselben Medaille – sie können einzeln, nacheinander oder gleichzeitig auftreten.
Die wichtigsten Ursachen einer bakteriellen Vaginose
Bakterielle Vaginose kann durch verschiedenste Faktoren begünstigt werden. Wer diese kennt, kann oft bereits im Vorfeld aktiv gegensteuern und einer Dysbiose vorbeugen
1. Antibiotika
Breitbandantibiotika können das bakterielle Gleichgewicht im Körper empfindlich stören. Sie zerstören nicht nur die krankheitserregenden Keime, sondern auch die schützenden Bakterien – etwa die wichtigen Laktobazillen. Dadurch steigt der pH-Wert in der Scheide, das gesunde Milieu kippt, und opportunistische Keime haben leichtes Spiel.
Ironischerweise kommen zur Behandlung der bakteriellen Vaginose wiederum Antibiotika zum Einsatz – ohne begleitenden Aufbau der Flora kann dies zu einem Teufelskreis führen.
Tipp: Antibiotika nur bei echter Notwendigkeit anwenden. Parallel oder im Anschluss durch gezielte Einnahme von Probiotika die natürliche Flora unterstützen.
2. Hormonelle Schwankungen
Östrogen sorgt dafür, dass das Vaginalepithel Glykogen produziert, einen Nährstoff, der den Laktobazillen zugutekommt. Sinkt der Östrogenspiegel z.B. durch hormonelle Veränderungen vor der Menstruation, nach der Geburt, während der Stillzeit oder in der Menopause so fehlt dieser Nährboden. Die Laktobazillen ziehen sich zurück, da sie weniger Nährstoffe vorfinden, der pH-Wert steigt und ungünstige Bakterien können sich ausbreiten.
Interessanterweise scheint hormonelle Verhütung hier eine gewisse Schutzfunktion zu entfalten: Frauen, die die Pille nehmen, sind Studien zufolge seltener betroffen, da vermutlich der Hormonspiegel stabiler ist.
Tipp: Auf den Östrogenspiegel achten und bei hormonellen Störungen in Absprache mit dem Arzt biodentische Hormone erwägen. Diese natürlichen Hormone werden häufig über Pflaster transdermal aufgenommen.
3. Sexualpartner
Sex allein verursacht keine bakterielle Vaginose. Doch wechselnde Partner bedeuten den Kontakt mit unterschiedlichen Mikrobiomen und das kann das eigene Gleichgewicht beeinflussen. Sperma selbst wirkt zudem basisch (pH-Wert ca. 7) und hebt den sauren pH-Wert der Vagina an.
Wichtig: Die bakterielle Vaginose ist keine klassische Geschlechtskrankheit, aber fremde Mikroorganismen können die Flora destabilisieren.

Tipp: Kondome reduzieren das Risiko einer Dysbiose. Sie verhindern nicht alle Effekte, aber deutlich mehr als ungeschützter Verkehr. Häufig wechselnde Partner sind nicht problematisch per se, doch ein Bewusstsein für die mikrobiellen Wechselwirkungen hilft. Auch mentale Faktoren wie Angst vor einer Dysbiose oder anderen Erkrankungen beeinflussen das Immunsystem negativ und können das Risiko einer bakteriellen Vaginose erhöhen.
4. Intimhygiene
Übertriebene Hygiene, insbesondere das Spülen der Vagina („Douching“), richtet mehr Schaden als Nutzen an. Wasser, Seifen oder antiseptische Lösungen spülen schützende Bakterien aus und stören das natürliche Gleichgewicht. Studien belegen, dass Douching mit einer höheren Rate an bakterieller Vaginose einhergeht. Auch parfümierte Intimpflegeprodukte oder aggressive Waschlotionen sind kontraproduktiv.
Die Scheide ist ein selbstreinigendes Organ. Es genügt warmes Wasser – maximal milde, pH-saure Lotionen für die äußere Vulvazone.
Tipp: Weniger ist mehr. Sanft reinigen – außen, nicht innen – und keine aggressiven Produkte verwenden. Slipeinlagen sollten unparfümiert und atmungsaktiv sein.
5. Ernährung
Was wir essen, beeinflusst nicht nur unser Darmmikrobiom sondern auch die Vaginalflora reagiert sensibel auf Nährstoffe, Mängel und Übermaß. Eine unausgewogene, vitamin- und mineralstoffarme Ernährung erhöht das Risiko für Dysbiosen. Studien zeigen Zusammenhänge zwischen bakterieller Vaginose und einem Mangel an Vitamin A, C, D, E, Beta-Carotin, Folsäure oder Calcium.
Auch eine zuckerreiche Ernährung, insbesondere mit Lebensmitteln hoher glykämischer Last, wirkt sich negativ aus: Sie begünstigt die Vermehrung von Hefepilzen und verschiebt das mikrobielle Gleichgewicht. Fettreiche Kost scheint ebenfalls einen negativen Einfluss zu haben.
Tipp: Eine ballaststoffreiche, pflanzenbetonte Ernährung mit viel Obst und Gemüse wirkt schützend. Vitamine gezielt ergänzen, insbesondere A, C, D und E. Zucker, Alkohol und stark verarbeitete Lebensmittel möglichst reduzieren.
6. Stress und psychische Faktoren
Chronischer Stress hat vielfältige Auswirkungen auf den Körper – und auch die Vaginalflora bleibt nicht verschont. Ein dauerhaft erhöhter Cortisolspiegel schwächt das Immunsystem, sodass opportunistische Keime leichter Fuß fassen. Zudem gehen mit Stress häufig ungesunde Begleitfaktoren einher: schlechter Schlaf, unausgewogene Ernährung, mehr Nikotin oder Alkohol. Das sind alles Belastungen für das fragile Gleichgewicht der Flora.
Tipp: Mentale Stabilität, regelmäßige Entspannung und gezieltes Stressmanagement stärken nicht nur das Wohlbefinden, sondern auch die vaginale Abwehrkraft. Achtsamkeitsübungen helfen nicht nur, innere Ausgeglichenheit zu fördern, sondern können auch die Wahrscheinlichkeit einer bakteriellen Vaginose mindern.
7. Umweltfaktoren
Auch Umweltgifte können das Scheidenmilieu empfindlich stören. Chemikalien in Kosmetika, chlorhaltiges Schwimmbadwasser oder Desinfektionsmittel im Intimbereich beeinträchtigen die mikrobielle Balance. Selbst Zigarettenrauch wirkt nachweislich negativ auf die Flora.
Tipp: Auf atmungsaktive Baumwollunterwäsche achten und synthetische Stoffe möglichst meiden. Nach dem Schwimmen nasse Kleidung schnell wechseln. Gechlorte Bäder nur in Maßen nutzen, denn weniger ist oft mehr.
Warum kehrt eine bakterielle Vaginose so häufig zurück?

Für viele Frauen ist die bakterielle Vaginose besonders frustrierend, weil sie trotz erfolgreicher Behandlung immer wieder auftritt. Tatsächlich erleben 50–80 % der Betroffenen innerhalb von 6 bis 12 Monaten nach einer Standardtherapie mit Antibiotika einen Rückfall. Der Grund: Oft wird lediglich das akute Ungleichgewicht behandelt aber nicht die zugrunde liegenden Ursachen. Die gesunde Vaginalflora kann sich ohne gezielte Unterstützung nur schwer und oft nicht dauerhaft regenerieren.
Hinzu kommt, dass bestimmte Erreger, allen voran Gardnerella vaginalis, auf der Vaginalschleimhaut widerstandsfähige Biofilme bilden. Diese schützen die Bakterien vor der vollständigen Elimination durch Antibiotika. Selbst wenn nur wenige überleben, reichen sie aus, um erneut eine Dysbiose zu provozieren.
Ein weiteres Problem ist die Wiederbesiedlung nach der Therapie. Die Laktobazillen müssen rasch und in ausreichender Zahl zurückkehren, um das bakterielle Gleichgewicht zu stabilisieren. Doch häufig kehrt als Pionierbesiedler zuerst Lactobacillus iners zurück, eine Art, die zwar schnell da ist, aber nicht so effektiv schützt wie etwa L. crispatus. Das heißt, dass, obwohl die Vagina mit Laktobazillen besiedelt ist, es oft die falschen sind, die kein dauerhaftes Gleichgewicht gewährleisten. Der schnell wachsende L. iners besetzt die Nische, verhindert, dass andere Lactobacillus-Arten sich ansiedeln, generiert aber nur eine instabile Flora, die schnell aus dem Gleichgewicht geraten kann. Dieses Phänomen, dass L. iners nach der Behandlung dominiert, scheint auch der Grund zu sein, warum bakterielle Vaginose oft schwer heilbar ist.
Die wichtige Rolle des Sexualpartners
Auch der Sexualpartner kann eine Rolle spielen. Viele Männer tragen Gardnerella oft symptomlos auf der Penisschleimhaut. Dies kann zu einem sogenannten „Ping-Pong-Effekt“ führen, d.h. trotz Behandlung kommt es zur erneuten Übertragung. Doch selbst das routinemäßige Mitbehandeln des Partners zeigt meist keinen positiven Effekt, weil Gardnerella auf dem Penis schnell wieder die Überhand gewinnt und auf die Vagina übertragen wird, noch bevor diese vollständig mit den richtigen Laktobazillen bewachsen ist.
In vielen Fällen ist daher auch nach einer Mitbehandlung des Partners für einige Zeit die Nutzung von Kondomen zu bevorzugen, damit sich die Laktobazillen-Flora in Ruhe regenerieren kann, ohne von Gardnerella wieder bedrängt zu werden.
Grundsätzlich ist die klassische Antibiotikabehandlung kritisch zu betrachten. Sie beseitigt selten alle Bakterien restlos. Überlebende Keime können sich schnell wieder vermehren. Aber auch im Falle einer restlosen Eradikation ist die Wiederbesiedelung ein Glücksspiel und hängt von vielen Faktoren ab.

So kann schon eine erneute Antibiotikabehandlung wegen einer ganz anderen Symptomatik, wie z. B. wegen einer Zahnbehandlung, die Laktobazillen wieder schwächen. Aber auch chronischer Stress im Job lässt das beginnende, noch zarte Gleichgewicht schnell wieder kippen. Zudem macht die bakterielle Vaginose die Vagina anfälliger für Pilzinfektionen, deren Behandlung dann wiederum eine bakterielle Vaginose zur Folge hat.
Das Dilemma der Ärzte
Hinzu kommt: Viele Diagnostikverfahren sind veraltet. Standardkulturen übersehen oft relevante Erreger, sodass Therapien ins Leere laufen. Neue Diagnostiktools jedoch können helfen, auch schwer detektierbare Besiedler nachzuweisen. Sie werden aber nur in wenigen Fällen vom behandelnden Arzt eingesetzt. Stattdessen wird eine „One-size-fits-all“-Lösung empfohlen, die für viele Frauen unzureichend ist. Dies geschieht oft aus Gründen des Zeitmangels, der Unkenntnis von den neuen Methoden, der „So-haben-wir-es-schon-immer-gemacht“-Verhaltensweise und auch aus abrechnungstechnischen Gründen. Der Arzt ist befindet sich oft in einem Dilemma: Er muss schnell und kostengünstig eine Lösung liefern, aber die bakterielle Vaginose erfordert nun mal eine tiefergehende Beratung, eine detailliertere Analyse und komplexere Behandlung.
Fazit
Die bakterielle Vaginose ist eine Herausforderung, aber nicht unlösbar. Mit Geduld, präziser Diagnostik und einem ganzheitlichen, auf die individuellen Ursachen abgestimmten Ansatz kann sie nachhaltig behandelt werden.
Im nächsten Artikel zeigen wir dir, wie du deine Vaginalflora langfristig stabilisieren und in ein gesundes Gleichgewicht zurückführen kannst.
Quellenverzeichnis und weiterführende Literatur
Han, Y., Liu, Z., & Chen, T. (2021). Role of vaginal microbiota dysbiosis in gynecological diseases and the potential interventions. Frontiers in Microbiology, 12, 643422. https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.643422
Lehtoranta, L., Ala-Jaakkola, R., Laitila, A., & Maukonen, J. (2022). Healthy vaginal microbiota and influence of probiotics across the female life span. Frontiers in Microbiology, 13, 819958. https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.819958
Liu, P., Lu, Y., Li, R., & Chen, X. (2023). Use of probiotic lactobacilli in the treatment of vaginal infections: In vitro and in vivo investigations. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 13, 1153894. https://doi.org/10.3389/fcimb.2023.1153894
Moore, K. H., Ognenovska, S., Chua, X.-Y., Chen, Z., Hicks, C., El-Assaad, F., te West, N., & El-Omar, E. (2024). Change in microbiota profile after vaginal estriol cream in postmenopausal women with stress incontinence. Frontiers in Microbiology, 15, 1302819. https://doi.org/10.3389/fmicb.2024.1302819
Morsli, M., Gimenez, E., Magnan, C., Salipante, F., Huberlant, S., Letouzey, V., & Lavigne, J.-P. (2024). The association between lifestyle factors and the composition of the vaginal microbiota: A review. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, 43, 1869–1881. https://doi.org/10.1007/s10096-024-04915-7
Reid, G. (2018). Promising prebiotic candidate established by evaluation of lactitol, lactulose, raffinose, and oligofructose for maintenance of a Lactobacillus-dominated vaginal microbiota. Applied and Environmental Microbiology, 84(5), e02200-17. https://doi.org/10.1128/AEM.02200-17
Valeriano, V. D., Lahtinen, E., Hwang, I.-C., Zhang, Y., Du, J., & Schuppe-Koistinen, I. (2024). Vaginal dysbiosis and the potential of vaginal microbiome-directed therapeutics. Frontiers in Microbiomes, 3, 1363089. https://doi.org/10.3389/frmbi.2024.1363089