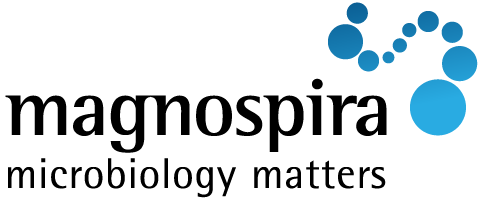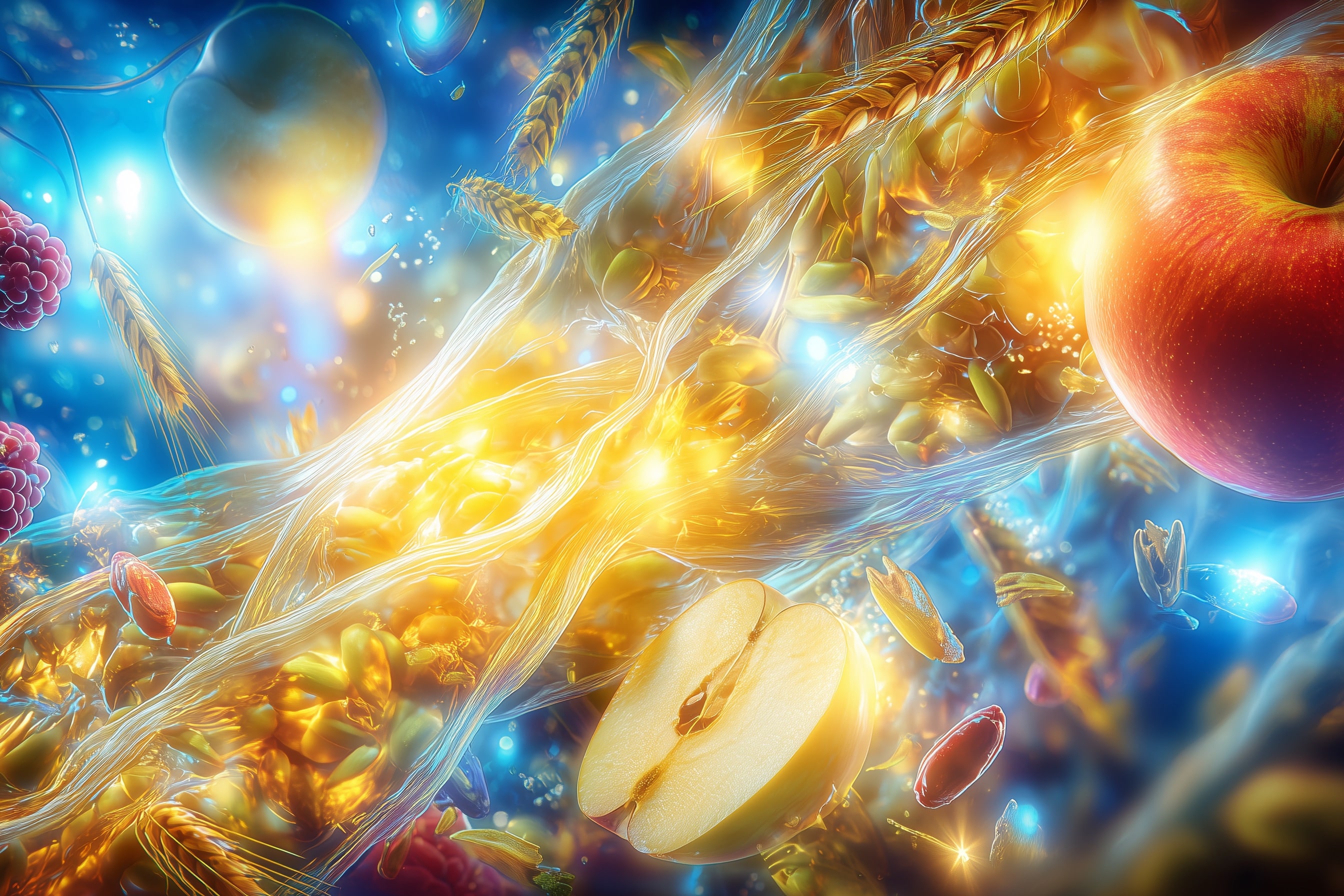Was passiert im Körper, wenn Kreatin auf dein Mikrobiom trifft?
Jahrzehntelang galt Kreatin nur als empfehlenswertes Nahrungsergänzungsmittel für Sportler und vor allem für Kraftsportenthusiasten. Doch neueste Ergebnisse zeigen, dass Kreatin mannigfaltige Wirkungen hat. Und auch unser Mikrobiom spielt dabei eine entscheidende Rolle.
Kreatin ist eine körpereigene Substanz, die aus den Aminosäuren Arginin, Glycin und Methionin in Leber, Niere und in der Bauchspeicheldrüse gebildet wird. 95 % des Kreatins befinden sich in der Skelettmuskulatur. Da Fleisch und Fisch am meisten Kreatin enthalten, besitzen Vegetarier geringere Spiegel. Pro Tag stellt der Körper 1–2 g selbst her und gibt ungefähr dieselbe Menge über den Urin wieder ab.
Wie funktioniert Kreatin?
Kreatin ist ein fantastischer Energiespeicher: Nicht nur für die Muskeln, sondern auch für das Gehirn. Dabei wirkt es schnell und unkompliziert, indem es im Körper enzymatisch zu Phosphokreatin umgewandelt wird und damit den Energiehaushalt beeinflusst. Denn im Körper gibt es die universelle Energiewährung ATP (Adenosintriphosphat). Dieses Molekül besitzt drei Phosphatgruppen und setzt beim Abspalten einer Phosphatgruppe Energie frei.
Kreatin sorgt dafür, dass es seine Phosphatgruppe schnell auf das entstehende ADP (Adenosindiphosphat) überträgt und dieses wieder zu ATP regeneriert, das dann wiederum als Energielieferant zur Verfügung steht.
Um es mit einem Bild zu erklären: Von einem Bogen wird ein Pfeil abgeschossen, und Kreatin stellt einfach superschnell wieder einen neuen Pfeil bereit. Das Ganze passiert innerhalb von Millisekunden.
Welche Effekte hat Kreatin?
Da Kreatin dafür sorgt, dass sehr schnell Energie nachgeliefert werden kann, kommt es zu Steigerungen im Training und damit zu messbaren Zuwächsen an Muskelkraft sowie zu einer Erhöhung der Durchschnittsleistung.
Es führt dazu, dass vermehrt Wasser in die Muskeln eingelagert wird, indem es mehr Ionen in die Zelle bringt. Diese erhöhte Teilchendichte muss durch vermehrte Wassereinlagerung ausgeglichen werden. Dies löst Wachstumsreize im Muskel aus, ist also ein durchaus positiver Effekt, der sich zwar in einer leichten Zunahme des Gewichts bemerkbar macht, die aber eben nicht auf Fett basiert. Die Gewichtszunahme kann je nach Kreatinaufnahme und Körpergewicht 1–3 kg betragen und geht etwa 4–6 Wochen nach Absetzen des Kreatins wieder verloren.
Da das Gehirn sehr viel ATP verbraucht, kann Kreatin durch die schnelle Wiederaufladung des Energielieferanten das Kurzzeitgedächtnis verbessern, die geistige Präsenz und Wachheit erhöhen und eventuell auch depressive Symptome mindern. Zusätzlich scheint es neurodegenerativen Krankheiten wie Parkinson vorzubeugen.
Welche Wechselwirkungen gibt es mit dem Mikrobiom?
Beeinflusst Kreatin das Mikrobiom? Neue Kenntnisse zu Kreatin-Mikrobiom-Interaktionen zeigen aufregende Einblicke.
Stärkung der Darmbarriere
Kreatin scheint sich positiv auf den Erhalt der Darmbarriere auszuwirken, indem es die Darmepithelzellen, also die Darmwände, mit Energie versorgt und dadurch stabilisiert. Schwache Darmwände führen zu einer Kontamination des Körpers mit Darmbakterien, zu Entzündungen und damit zum gefürchteten „Leaky-Gut“-Syndrom. Umgekehrt sind niedrige Kreatinspiegel im Darm Anzeichen für bevorstehende entzündliche Darmerkrankungen.
Schutz bei Krebsstrahlentherapie
Im Tierversuch erwies sich Kreatin als Schutzfaktor bei Strahlenstress. Durch eine bestimmte Ernährungsweise – die zeitlich begrenzte Fütterung – wurde das Mikrobiom verändert und das Wachstum bestimmter Bifidobakterien gefördert. Dies führte zu einer erhöhten Kreatinkonzentration im Darm. Wahrscheinlich hemmten diese Bakterien den Abbau von Kreatin durch andere Mikroorganismen.
Das vermehrt verfügbare Kreatin unterstützte in den Darmepithelzellen die schnelle Wiederherstellung von ATP und aktivierte dadurch zelleigene Schutzmechanismen. So konnte der strahleninduzierte Zelltod (Ferroptose) gehemmt werden. Dieser Mechanismus könnte künftig zum Schutz der Darmschleimhaut bei Krebsbehandlungen beitragen, bei denen Schleimhautschäden und erhöhte Darmdurchlässigkeit häufige Nebenwirkungen sind.
Positiver Einfluss auf Neurodegenerative Erkrankungen
Versuche mit bestimmten probiotischen Stämmen, wie Bifidobacterium animalis subsp. lactis, zeigten, dass diese über eine Veränderung der Darmmikrobiota die Kreatinverfügbarkeit erhöhen und neurologische Funktionen positiv beeinflussen können. Damit könnten positive Effekte auf die Verhinderung oder Behandlung von Morbus Parkinson möglich sein. So vermutet man schon seit längerem, dass bei Parkinson das Darmmikrobiom eine wesentliche Rolle spielt, da es eine direkte Verbindung zum Gehirn über die Darm-Hirn-Achse besitzt. (hier anmelden: unser kostenloses Webinar zur Darm-Hirn-Achse)
Das Darmmikrobiom kann dabei die Entstehung von Parkinson auf mehreren Wegen beeinflussen. So können Bakterien bestimmte Stoffe bilden, die in das Zentralnervensystem gelangen und dort entzündliche Prozesse der Neuronen fördern (schädliche Bakterien) oder hemmen (gute Bakterien). Auch die Produktion der SCFAs (kurzkettige Fettsäuren) wie Butyrat kann entzündungshemmend wirken. Im Gegensatz dazu kann eine erhöhte Darmdurchlässigkeit Parkinson wiederum fördern.
Es gibt also positive wie auch negative Wechselwirkungen zwischen Mikrobiom und Parkinson. Entscheidend ist, dass durch eine gesunde Lebensweise die positiven Bakterien gefördert werden. In präklinischen Studien konnte gezeigt werden, dass bestimmte probiotische Bakterien den Kreatinspiegel erhöhten, die neurologischen Funktionen verbesserten und zu einer Reduktion entzündlicher Prozesse führten, was letztlich dazu beitragen könnte, eine Parkinson-Erkrankung zu verhindern.
Höhere Knochengesundheit
Das Mikrobiom kann durch die Bildung von SCFAs die Kalziumaufnahme im Darm fördern und zu einer erhöhten Kreatinverfügbarkeit beitragen. Präklinische Studien zeigen, dass Kreatin die Knochendichte indirekt über den Muskelaufbau erhöhen und zusätzlich Osteoblasten, die für den Knochenaufbau verantwortlich sind, positiv beeinflussen kann.
Erhöhte Verfügbarkeit von Kreatin
Ein Mikrobiom, das von schädlichen Bakterien dominiert wird, führt zu einem verstärkten Abbau von Kreatin und damit zu einer geringeren Verfügbarkeit. Dieser Effekt nimmt im Alter zu. Dies könnte mitverantwortlich dafür sein, dass im Alter zunehmend eine geringere Kreatinverfügbarkeit und damit verbundene Muskelschwäche beobachtet werden. Sarkopenie, der Verlust von Muskelmasse und -funktion im Alter, beeinträchtigt Gesundheit und Lebensqualität älterer Menschen erheblich.

Umgekehrt können „gute“ Bakterien die Verfügbarkeit von Kreatin erhöhen und damit die Effekte einer Kreatinsupplementation unterstützen. Es erscheint wahrscheinlich, dass Probiotika und Kreatin künftig therapeutisch kombiniert werden, um Alters-Sarkopenie effektiver zu behandeln. Auch Präbiotika wie Inulin, also Ballaststoffe, die das Wachstum nützlicher Bakterien fördern, können über eine gesunde Darmflora die Kreatinaufnahme und -wirkung verbessern.
Gegenseitige Beeinflussung
Aktuelle Forschungsergebnisse zeichnen damit ein Bild, in dem sich Kreatin und das Mikrobiom gegenseitig beeinflussen:
Das Mikrobiom kann die Verfügbarkeit und Wirkung von Kreatin erhöhen, während umgekehrt Kreatin durch die Stärkung der Darmbarriere und über Stoffwechseleffekte die Darmflora und damit die Gesundheit insgesamt verbessert.
Praktische Relevanz
Was bedeutet das und wie kann dieses Wissen bestmöglich umgesetzt werden?
Eine Supplementierung mit Kreatin zwischen drei und fünf Gramm täglich ist gesundheitlich absolut unbedenklich und hat mannigfaltige positive Effekte. Sarkopenie beginnt ab etwa dem 30. Lebensjahr schleichend und wird ab 50+ klinisch relevant. Daher ist gerade mit zunehmenden Lebensjahren nicht nur auf eine ausreichende Kreatinversorgung zu achten, sondern auch auf ein gesundes Mikrobiom, damit dessen förderliche Wirkung auf die Kreatinverwertung nicht verloren geht.
Es lohnt sich praktisch immer, sich um sein Mikrobiom zu kümmern. In nahezu allen Lebensbereichen spielt es eine wesentliche Rolle und beeinflusst damit maßgeblich unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden.
Kreatin ist damit längst nicht mehr nur ein Supplement für Bodybuilder, sondern ein essenzieller Stoff, der, zusammen mit einem gesunden Mikrobiom, unsere Muskeln schützt, potenziell neurodegenerativen Erkrankungen vorbeugt, die Gehirnleistung verbessert und die Darmwände stabilisiert.
Kreatin hat also eine positive Wirkung auf das Mikrobiom und umgekehrt.
Literaturverzeichnis
Avgerinos KI, Spyrou N, Bougioukas KI, Kapogiannis D. Effects of creatine supplementation on cognitive function of healthy individuals: A systematic review of randomized controlled trials. Exp Gerontol. 2018 Jul 15;108:166-173.
Bonilla, D. A., et al. (2021). Metabolic Basis of Creatine in Health and Disease: A Bioinformatics-Assisted Review. Nutrients, 13(4), 1238.
He Y. et al. (2025). Creatine-mediated ferroptosis inhibition is involved in the intestinal radioprotection of daytime-restricted feeding. Gut Microbes, 17 (1), 2489072.
Lempert K.D. (2019). Probiotics and CKD Progression: Are Creatinine-Based Estimates of GFR Applicable?. American Journal of Kidney Diseases, 74 (4), 429–431.
Peng Z. et al. (2023). Creatine supplementation enhances anti-tumor immunity by promoting adenosine triphosphate production in macrophages. Frontiers in Immunology, 14, 1176956.
Roberts M.D. & Rawson E.S. (2021). Metabolic Basis of Creatine in Health and Disease: A Bioinformatics-Assisted Review. Nutrients, 13 (4), 1238.
Schimmel P. et al. (2023). The infant gut microbiota: in pursuit of non-protein nitrogen. Gut Microbes, 15 (1), 2211917.
Wallimann T. et al. (2021). Creatine Supplementation for Patients with Inflammatory Bowel Diseases: A Scientific Rationale for a Clinical Trial. Nutrients, 13 (5), 1429.
Zhang Z. et al. (2024). Bifidobacterium animalis Probio-M8 improves sarcopenia physical performance by mitigating creatine restrictions imposed by microbial metabolites. npj Biofilms and Microbiomes, 10, 144.